Die Welt ist verrückt – das könnte man meinen, sollte man aber nicht mehr sagen. Es könnte verletzend wirken
Immer mehr Wörter sollen wegen ihrer angeblich problematischen Bedeutung verschwinden: An der Stanford University wurde «crazy» jüngst auf einen Index gesetzt. Zugleich werden immer mehr Phrasen produziert, die gar nichts mehr bedeuten. Beide Tendenzen gefährden das Denken.

Zu Weihnachten habe ich ein tolles Buch bekommen. Das Buch heisst «Buch», und dieses «Buch» ist durchaus ein richtiges Buch, eines mit einem Umschlag aus Karton und Seiten aus Papier und vielen Buchstaben drin, was bei einem «Buch» ja nicht unbedingt selbstverständlich ist. Ein Buch in Anführungszeichen könnte zum Beispiel eine Schmuckschatulle sein, die aussieht wie ein Buch, oder es könnte ein Parfumflacon enthalten anstatt Seiten. Im Prinzip wäre es auch ziemlich feinfühlig gewesen, einer Person, die von Berufs wegen dauernd lesen muss, ein solches «Buch» zu schenken. Ich hätte mich gefreut darüber. Aber noch besser hat mir dieses richtige Buch gefallen: das «‹Buch› der absurden Anführungszeichen».
Publiziert hat es Hans Rusinek, ein nicht weiter bekannter deutscher Autor, der sich einer interessanten Aufgabe verschrieben hat: Rusinek sammelt Gänsefüsschen. Schon seit einigen Jahren füllt er einen Instagram-Kanal mit Beispielen von Wörtern, die auf Schildern, Speisekarten oder Plakaten auf komische Weise von Anführungszeichen umklammert werden. Einige dieser Trouvaillen macht Rusinek nun in seinem «Buch» zugänglich.
Es ist ein grosser Rätselspass. Was zum Beispiel hat es zu bedeuten, wenn eine Kirchgemeinde zum Orgelkonzert einlädt mit den Worten: «Der Eintritt ist ‹freiwillig›»? Worauf muss man sich einstellen, wenn ein Restaurant «durchgehend ‹gute› Küche» verspricht? Und was genau bietet der Massagesalon an, der «klassische Massagen ‹ohne Erotik›» verkauft? Man möchte es vielleicht lieber nicht wissen.
Dass typografische Zeichen Komik erzeugen, ist nichts Neues. Es gibt Leute, die statt Gänsefüsschen falsch gesetzte Apostrophe sammeln («Anana’s aus Costa Rica») oder sich mit bizarren Bindestrichen («Kicher-Erbsen») vergnügen. Aber während man in diesen Fällen vor simplen Fehlern steht, hat es mit den Anführungszeichen noch eine andere Bewandtnis. Denn die Form des Sprechens, die die Gänsefüsschen signalisieren, ist weit verbreitet.
Alles wird Phrase
Wörter, die in Anführungszeichen auftreten, deuten darauf hin, dass sie in einem uneigentlichen Sinn verwendet werden. Das Gesagte ist nicht das Gemeinte, man geht auf Distanz zur wörtlichen Bedeutung oder gibt zu erkennen, dass dahinter noch etwas anderes stecke. Was genau, ist selten restlos klar. Wenn Begriffe im übertragenen Sinn verwendet werden, bleibt ihre Bedeutung in der Unschärfe, siehe: «Massage ‹ohne Erotik›».
Dieses konkrete Beispiel ist selbstverständlich nichts als ein Fauxpas. Auch wer in seinem Restaurant «durchgehend ‹gute› Küche» offeriert, will nichts im Unklaren lassen. Er hat bloss eine unglückliche Form der Hervorhebung gewählt. In anderen Situationen aber hat das Diffuse System. Man denke zum Beispiel an all die CEO, die ihre Mitarbeiter zu «Agilität» anhalten, vielfältigen «Herausforderungen» mit «optimierten Prozessen» begegnen wollen und in «Transformationsphasen» zunächst die «tief hängenden Früchte» abzupflücken empfehlen.
Wenn solche Begriffe auf Power-Points erscheinen, fehlen zwar meist die Anführungszeichen. Doch wären sie gerade hier vonnöten. Manager-Jargon ist uneigentliches Sprechen in Reinform. Es werden Massen von Wörtern abgesondert, die nicht das bedeuten, was sie eigentlich bezeichnen («Herausforderungen» beispielsweise sind in aller Regel Probleme), und in den nebulösen Schwallen, in denen sie aufzutreten pflegen, gar jeden Sinn verlieren. Die Sprache verkommt zur Phrase.
Diese Tendenz ist umfassend. In Politik oder Wirtschaft, Kommunikations- oder Beratungswesen wird genauso unklar gesprochen wie in jeder beliebigen Zahnarztpraxis: «Professionalität steht bei uns im Zentrum. Qualität ist unser höchstes Gebot.» Solches Gerede ist derart generisch, dass es sich problemlos auch auf jede Sanitärbude übertragen liesse.
Bloss keine Unschärfe!
Paradoxerweise steht diesem Hang zum uneigentlichen Sprechen ein ebenso starker Trend gegenüber, der in die umgekehrte Richtung verläuft. Das Gendern zum Beispiel ist geradezu als Negation von allem Generischen zu verstehen. Nichts darf mehr unscharf bleiben, vielmehr hat jedes Geschlecht, jede gefühlte Identität die ihr präzise entsprechende, ihre eigentliche sprachliche Form zu erhalten.
Anstatt dass Wörter wie «Leser» geschlechtlich offengehalten werden, sollen unterschiedliche Zeichenfolgen («Leser*in») die diversen Identitäten sichtbar machen. Böte unsere Sprache die Möglichkeit dazu, würden wir mithilfe grammatischer Formen sicher längst auch nach Hautfarbe, Alter und Herkunft differenzieren, um mit unseren Wörtern möglichst nah ans vermeintliche Wesen der Dinge zu kommen und Ambivalenzen und Vieldeutigkeiten auszuräumen.
Unschärfe wird aber nicht nur dadurch bekämpft, dass möglichst spezifische Formen verwendet werden. Was auf unliebsame Weise mehrdeutig erscheint, soll zuweilen auch einfach aus dem Gebrauch gekippt werden. Die Debatten, die wir in den letzten Jahren um das Wort «Mohrenkopf» führten, sind nicht mehr zu zählen – insgesamt aber noch als recht vernünftig zu bezeichnen im Vergleich zu Diskussionen, die in den USA angestossen werden. Just letzte Woche ist eine Liste der Universität Stanford an die Medien gelangt: Unter dem Titel «Elimination of Harmful Language Initiative» hat das IT-Department der Hochschule über hundert Wörter und Wendungen zusammengetragen, die nicht mehr zu gebrauchen seien.
Darauf finden sich nicht etwa hauptsächlich Ausdrücke, die, wie unser «Mohr», vor dem Hintergrund der Kolonialgeschichte als Herabwürdigung erscheinen können. Auch Wörter wie «landlord/landlady», welche die Geschlechtervielfalt nicht ausreichend abbilden, machen nur einen kleinen Teil der Liste aus. Nein, in der Mehrheit geht es um Alltagswörter wie zum Beispiel «crazy»: Dieses Adjektiv, lehren die Verfasser der Liste, trivialisiere die Erfahrungen von Menschen mit psychischen Problemen.
Vorsicht vor der Triggerwarnung
Weg soll bitte auch der «Indian summer». Denn dieser Sommer kommt spät im Jahr und lege folglich nahe, dass Indigene chronisch unpünktlich seien. Der «user» wiederum sei problematisch, da über das darin mitklingende Verb «to use» auch schmerzhafte Drogenabhängigkeiten oder Missbrauchserfahrungen aufgerufen werden könnten; besser würde man «client» sagen. «Webmaster» soll man durch «web product owner» ersetzen, da im «master» der Sklavenhalter stecke.
Nach negativen Presseberichten betonte die Stanford University, dass die Liste keinen offiziellen Charakter habe, sondern lediglich als Diskussionsgrundlage im IT-Department diene. Das Wort «American» etwa sei in Stanford weiterhin ausdrücklich willkommen – auf der Liste wird es zur Eliminierung empfohlen, weil es suggeriere, dass die USA das wichtigste Land auf dem amerikanischen Doppelkontinent seien, der doch in Wahrheit aus 42 Staaten bestehe.
Auch wenn das alles kein Witz ist: Man muss bei der Lektüre der Stanford-Liste immer wieder lachen, denn die akribische Suche nach dem vermeintlichen Bedeutungskern der Wörter hat etwas Absurdes. Da dieser Kern stets im Problematischsten gefunden wird – der «master» ist selbstverständlich der Sklavenhalter, nicht etwa der generische Meister –, müssen die untersuchten Wörter weichen, auf dass sie keinen verletzen. Aus diesem Grund, es ist der Gipfel der Ironie, steht auch die «Triggerwarnung» auf der Stanford-Liste – das Wort könne Stress auslösen. Ersonnen, um auf möglicherweise traumatisch wirkende Inhalte hinzuweisen, wird nun das Wort selber zum Problem. Die Revolution frisst ihre Kinder.
Kommunikation wird unmöglich
Wo Wörter in dieser puristischen Manier auf ihre angeblich echte Bedeutung hin abgeklopft werden, wird Sprache zur Unmöglichkeit. Übertragung und Ausdehnung sind Grundprinzipien ihres Funktionierens, auch wenn wir das kaum noch merken. Zum Beispiel treiben wir «Handel», weil die Hand eine zentrale Gliedmasse des Menschen ist; wir sind «verblendet», wenn wir die Dinge nicht mehr in den richtigen Zusammenhängen sehen – wobei wir mit «sehen» eigentlich begreifen meinen, und in «begreifen» wiederum ist das sinnliche Erfassen und Ertasten enthalten. Sollte man aufhören, so zu reden, um Blinde nicht zu verletzen oder Menschen, die ohne Arme zur Welt kamen? Man müsste bald ganz schweigen.
Aber natürlich gibt es auch dort keine Verständigung mehr, wo das Gegenteil passiert. Im Jargon der Maskierung, im Bereich der «agilen Prozessoptimierung» und der «Strategien für eine erhöhte Kundenzufriedenheit», in diesem Alltagssprech, der aus blossen Phrasen und aufgeblähten Floskeln besteht, wird unfassbar viel gesagt und nichts gemeint. Man könnte auch ganz schweigen.
Im einen Fall wird Sprache zur Waffe überhöht, die ihren Benutzern eine gefährliche Macht verleiht und deswegen nur mit äusserster Vorsicht zu gebrauchen ist. Im anderen Fall wird sie zur Nebelmaschine degradiert, die ausser Verwirrung nichts bringt und eben darum im Übermass zum Einsatz kommt. Beides ist bedenklich. Denn vor allem wäre die Sprache eines: unser bestes Mittel, um Gedanken zu formen. Soll sich das menschliche Denken weder in nichts auflösen noch in eindimensionalen, starren Formen verlieren, ist eine entsprechende Sprache vonnöten. Wir brauchen Wörter, die mit ausreichender Präzision verwendet werden und dabei genügend offenbleiben, um freies Denken zu ermöglichen und der Vorstellungskraft ihren Spielraum zu lassen.
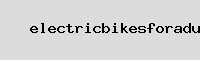

Author: Teresa Foster
Last Updated: 1703453642
Views: 2358
Rating: 4.3 / 5 (117 voted)
Reviews: 92% of readers found this page helpful
Name: Teresa Foster
Birthday: 2019-08-21
Address: Unit 7305 Box 0379, DPO AE 57678
Phone: +3531822443620353
Job: IT Consultant
Hobby: Writing, Stamp Collecting, Camping, Quilting, Golf, Knitting, Board Games
Introduction: My name is Teresa Foster, I am a rich, Colorful, bold, Adventurous, lively, receptive, rare person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.